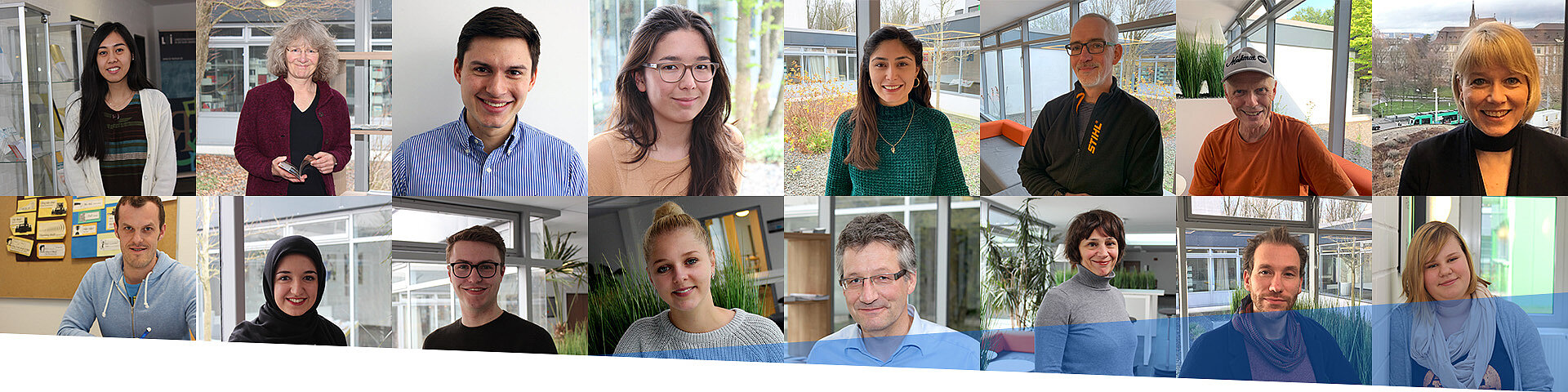Dr. Alexandra Hey
Koreanisch 1 + 2
02.05.2023
Als Unternehmensberaterin hat Wirtschaftspsychologin Dr. Alexandra Hey mehrere Jahre in Moskau gearbeitet - nicht zuletzt dank hervorragender Russischkenntnisse. Jetzt sucht sie eine neue sprachliche Herausforderung und hat eine asiatische Sprache gewählt: Koreanisch. Für zwei aufeinander folgende Intensivkurse ist sie, über 30 Jahre nach ihrem ersten Russischkurs am LSI, wieder nach Bochum gekommen.

»Der Kurs hier gefällt mir super, alles ist sehr, sehr professionell. Es macht großen Spaß, ist aber auch anstrengend. Ich bin froh, hier vor Ort und damit durch nichts abgelenkt zu sein.«
Frau Hey, vier Wochen Intensivsprachkurs, das bedeutet ein enormes Pensum von insgesamt 180 Unterrichtsstunden. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden und was war Ihre Motivation, Koreanisch in dieser intensiven Form zu lernen?
Zum ersten Mal war ich 1989 hier. Ich hatte schon in der Schule Russisch gelernt und war noch hin und her gerissen, was ich studieren wollte - die Tendenz ging Richtung Slawistik. Vor dem Studienbeginn in München hatte ich noch Zeit, die ich für einen Russisch-Intensivkurs am LSI genutzt habe. Die Empfehlung kam, wenn ich mich richtig erinnere, von meiner damaligen Russischlehrerin.
Eine gute Zeit, um Russisch zu lernen. Mit der Wende öffnete sich der Eiserne Vorhang und ein direkter Austausch mit der ehemaligen Sowjetunion wurde möglich. War das der Hintergrund, vor dem Sie sich zum Slawistik-Studium entschlossen haben?
Die Faszination für die russische Sprache und Fremdsprachen allgemein war schon vorher da. In Englisch und Französisch war ich gut in der Schule, es lag für mich nahe, Russisch als dritte Fremdsprache zu wählen. Es hat mich dann auch noch mal besonders begeistert, so sehr, dass mein Opa gefragt hat: Bist Du jetzt Kommunistin (lacht)? Es war die Zeit von Gorbatschow und Perestroika, viele neue Möglichkeiten taten sich auf. Neben Slawistik habe ich Psychologie und Volkswirtschaftslehre studiert, die Idee war: Ich werde mal Managerin in Russland.
Sind Sie Managerin in Russland geworden?
Mit einer langen Vorgeschichte, ja. Zunächst habe ich gemerkt, dass ich an der Uni sprachlich gar nicht viel weiter kam. Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft haben mir Spaß gemacht, aber es schwebte schon die Frage im Hintergrund: Was machst Du damit beruflich? Am Ende ging es in Richtung Wirtschaftspsychologie. So bin ich als Psychologin mit Schwerpunkt Wirtschaft ins Berufsleben gestartet und war dann in vielen großen Unternehmen tätig, zunächst in der Organisationsentwicklung und im Change Management, später dann in der Optimierung von Prozessen, Lean Management und Six Sigma. In dieser Rolle war ich 11 Jahre lang bei der Axa, einer großen Versicherung, und habe dann ein Angebot der größten russischen Bank bekommen.
Hatten Sie vorher im Berufsleben schon mit Osteuropa bzw. Russland zu tun?
Ja, im Head Office des Axa-Konzerns in Paris. Dort habe ich auch Russisch gesprochen, insbesondere, was heute etwas seltsam klingt, mit den Kollegen unserer Niederlassung in der Ukraine. Ansonsten vor allem privat. 1999 war ich für einen freiwilligen Einsatz mit Jugendlichen in Kirgistan. Dort habe ich meine Frau kennengelernt, mit der ich heute in Köln lebe. Mittlerweile kann sie Deutsch, aber wir haben zu Beginn nur Russisch miteinander gesprochen. Als das Angebot der Bank kam, war ich Anfang 40 und gefühlt schon irgendwie angekommen. Deshalb habe ich erst mal abgelehnt. Aber die Herausforderung war doch zu reizvoll. Aus heutiger Sicht riskant, aber am Ende hat es funktioniert und ich war über drei Jahre in Moskau.
Wie fühlt es sich an, beruflich in einer fremden Sprache agieren zu müssen - selbst wenn man diese gut beherrscht?
Die Arbeit in der Bank war nochmal eine neue Herausforderung, vor allem die vielen offiziellen Dokumente, deren Bezeichnungen ich natürlich nicht in meinem Vokabular hatte. Die Russen haben die Bürokratie ja von den Deutschen gelernt und noch etwas russische Willkür hinzugefügt. Es gibt unzählige Dokumente, die durch eine komplizierte Hierarchie geordnet sind, angefangen beim »приказ«, was sich in etwa mit »Befehl« übersetzen lässt. Die Herausforderung ist dabei nicht nur sprachlicher, sondern vor allem kultureller Natur.
Dass zu jener Zeit in einer russischen Bank Englisch gesprochen wurde, war nicht üblich?
Zu Beginn hatte ich einen Amerikaner als direkten Vorgesetzten, der sprach kein Russisch und hatte immer eine Dolmetscherin dabei. Als sie das Team zusammengestellt haben, haben sie mithilfe eines Headhunters aber weltweit nach Leuten gesucht, die nicht nur die Methodik, sondern auch Russisch beherrschten.
Wie war ihr Alltag in Russland?
Unkompliziert. Ich habe in Moskau gelebt, ganz in der Nähe des Kreml. Es war eine tolle Zeit in einer tollen Stadt. Aber die Stimmung ist bei mir runtergegangen, als 2014 die Krim besetzt wurde. Am Tag vor meiner Abreise wurde Boris Nemzow ermordet, auf der Brücke, die quasi die Verlängerung meiner Straße bildete. Irgendwie war ich dann auch froh, dass meine Zeit dort vorbei war.
Jetzt haben Sie ein neues Ziel ins Auge gefasst: Koreanisch. Wie kam es dazu?
Das spukte mir schon lange im Kopf rum. Ich wollte auf jeden Fall noch mal eine ostasiatische Sprache lernen. Eine, die ich auch lesen und schreiben kann. Bei Chinesisch mache ich mir da keine Illusionen (lacht). Japanisch hatte ich auch überlegt, aber ich habe mich für Koreanisch entschieden. Es war mir klar, dass ich es nicht nebenher machen will, somit lief es auf einen Intensivkurs hinaus, für den ich mir Urlaub genommen habe. Ich hatte überlegt, dafür nach Korea zu gehen, aber da wäre der Reiz groß gewesen, neben dem Sprachunterricht auch Sightseeing zu machen. Ich habe mich deshalb wieder für das LSI entschieden, wegen des superintensiven Lernens, bei dem man den ganzen Tag eigentlich nichts anderes macht als Unterricht und Hausaufgaben. Mein Ziel ist eine stabile sprachliche Basis, auf der ich dann in anderer Form weiterlernen kann, auch berufsbegleitend.
Sind mit Koreanisch berufliche Ziele für Sie verbunden?
Nein, gar nicht. Mich faszinieren Sprachen mit anderen Buchstaben. Zu Schulzeiten habe ich es an der VHS schon mal mit Arabisch versucht, aber da kommt man auf keinen grünen Zweig mit einmal Unterricht in der Woche.

Kommt das Intensivkurs-Format Ihrer Art zu Lernen entgegen?
Der Vorteil dabei ist: man bekommt im Intensivkurs sehr schnell eine sprachliche Basis. Als wir damals Russisch in der Schule gelernt haben, hatten wir alle Zeit der Welt, aber als Berufstätiger hat man die eben nicht mehr. Die koreanische Schrift - Hangul - haben wir an einem Tag gelernt, dann ging es direkt los mit der Grammatik. Wenn die Grundlagen gelegt sind, kann man alleine weiterlernen. Den Wortschatz erweitern, das geht auch nebenher. Aber von Null an? Da ist ein Intensivkurs schon optimal. Der Kurs hier gefällt mir super, alles ist sehr, sehr professionell. Es macht großen Spaß, ist aber auch anstrengend. Ich bin froh, hier vor Ort und damit durch nichts abgelenkt zu sein. Oft sitze ich noch bis zehn Uhr abends im Zimmer und wiederhole den Stoff. Die Vokabeln haben ja keinerlei Ähnlichkeit mit irgendetwas, was man kennt, das sind zunächst mal nur sinnlose Silben.
Die Kursgruppe besteht neben Ihnen aus drei Studentinnen. Ist es ungewöhnlich für Sie, mit Teilnehmerinnen zu lernen, die deutlich jünger sind als Sie?
Mit 19 war ich die Jüngste im Kurs, jetzt bin ich die Älteste (lacht)! Ich glaube, das war eher für die anderen komisch am Anfang, weil deren Mütter ungefähr in meinem Alter sind. Aber im Ernst: Wir verstehen uns sehr gut, sind auf einem Level, haben die gleichen Herausforderungen und Probleme zu meistern und kämpfen mit den gleichen Wörtern. Ich habe ja schon mehrere Fremdsprachen gelernt, das hilft.
Was würden Sie sagen: Ist Koreanisch vom Klang und Schriftbild her eine schöne Sprache?
Hangul wurde als Schriftsystem im 15. Jahrhundert eigens für die koreanische Sprache entwickelt. Ich finde es faszinierend, denn es ist keine Buchstabenschrift, wie wir sie kennen, aber auch keine Silbenschrift. Ich habe mal gelesen, eine Sprache klinge besonders schön, wenn sich Konsonanten und Vokale eins zu eins abwechseln. Koreanisch kommt dem relativ nah. Oft wird noch ein Vokal eingeschoben, damit nicht zwei Konsonanten miteinander kollidieren. Man macht sich also aus ästhetischen Gründen die Mühe, Elemente einzufügen, die gar nicht nötig wären, womit sich die Frage eindeutig mit ja beantworten lässt!
Interview: Jörg Siegeler